1. Begriff
„Abendmahl“ ist die vor allem im protestantischen Sprachgebrauch übliche Bezeichnung für den zentralen, mit Brot und Wein vollzogenen Ritus des Gottesdienstes in den meisten christlichen Denominationen. Andere Begriffe für dieses Geschehen sind Eucharistie oder, besonders im ökumenischen Kontext, Herrenmahl. In ihm wird des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern, das er nach den Berichten der synoptischen Evangelien am Donnerstag vor seiner Hinrichtung gefeiert hat, gedacht. Im kirchlichen Gebrauch zählt es in der Regel zu den Sakramenten, also zu denjenigen Riten, die zeichenhaft das im Leben und Sterben Jesu Christi begründete Heil an die Glaubenden vermitteln. Es ist einerseits von den anderen Sakramenten unterschieden (die in den Konfessionen unterschiedlich gezählt werden), andererseits von der Agape, dem allgemeinen Liebesmahl, in welchem die Gemeinde durch das Brotbrechen Christus erinnert und die eigene Gemeinschaft symbolisch gestaltet.
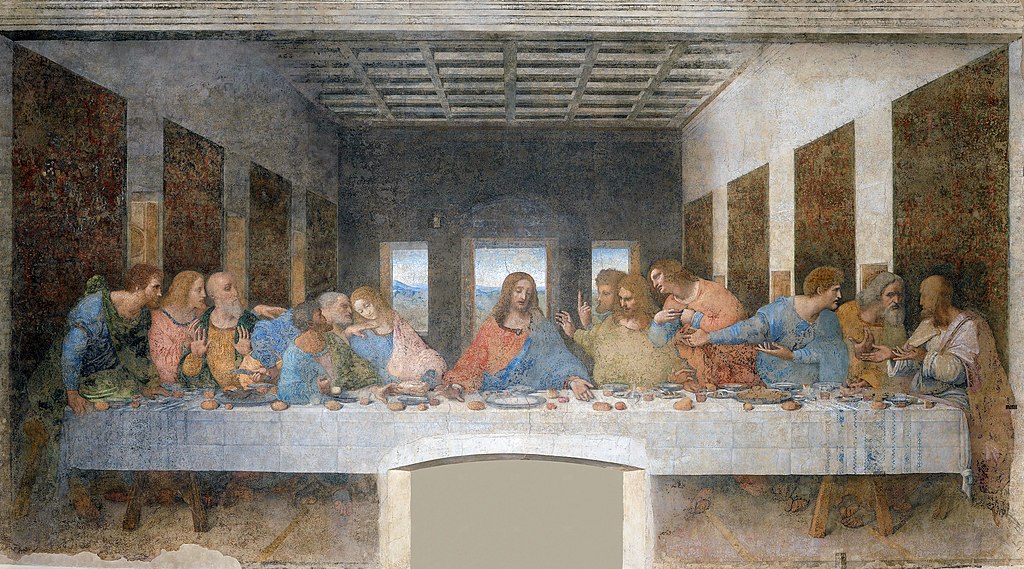
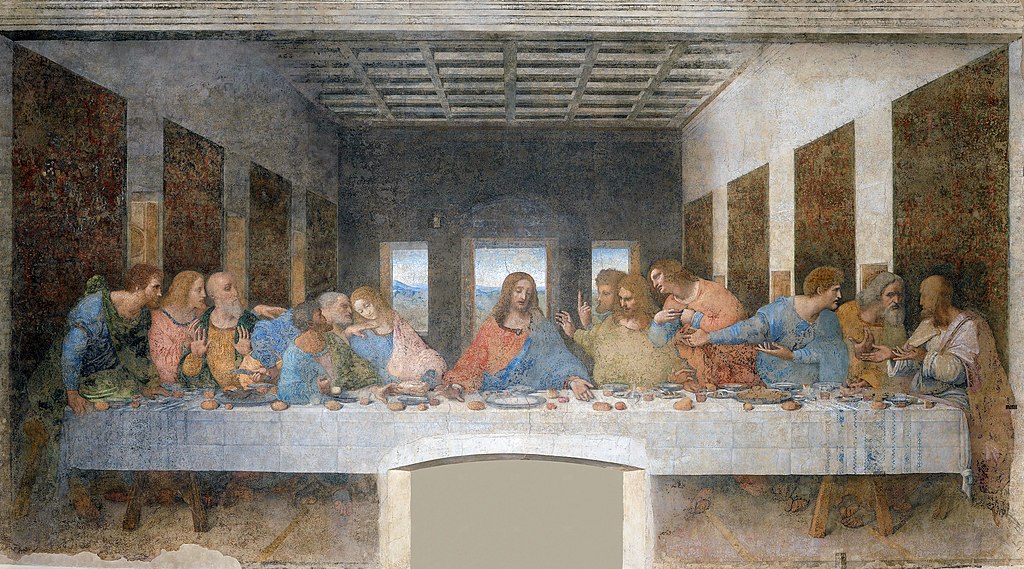
2. Biblische Grundlagen
Die biblischen Berichte konzentrieren sich auf die Benennung der historischen Verankerung in der Passionsgeschichte Jesu einerseits, andererseits auf die deutenden Worte Jesu zu den Elementen Brot und Wein („Einsetzungsworte“: Mt 26,26–29[26] Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach’s und gab’s den Jüngern und sprach: Nehmet, esset; das ist mein Leib. [27] Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus; [28] das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. [29] Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich.Zur Bibelstelle; Mk 14,22–25[22] Und als sie aßen, nahm er das Brot, dankte und brach’s und gab’s ihnen und sprach: Nehmet; das ist mein Leib. [23] Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den; und sie tranken alle daraus. [24] Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. [25] Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes.Zur Bibelstelle; Lk 22,15–20[15] Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen, ehe ich leide. [16] Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. [17] Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch; [18] denn ich sage euch: Ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. [19] Und er nahm das Brot, dankte und brach’s und gab’s ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis. [20] Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird!Zur Bibelstelle; 1Kor 11,23–26[23] Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe: Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, [24] dankte und brach’s und sprach: Das ist mein Leib für euch; das tut zu meinem Gedächtnis. [25] Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. [26] Denn sooft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.Zur Bibelstelle). Sie geben offenkundig gemeindliche Praxis der frühen Christ:innen wieder und normieren sie zugleich. Ihr Wortlaut variiert zwischen Mt und Mk einerseits, Lk und Paulus andererseits, vor allem im Blick auf die unmittelbare Identifikation des Kelches als „Blut des Bundes“ (Mt / Mk) oder als „Bund in meinem Blut“ (Lk / 1Kor). Zudem überliefern Lk und Paulus eine unmittelbare Aufforderung jenes erste Abendmahl „zu meinem Gedächtnis“ nachzuahmen, die bei Mt und Mk fehlt. In der im frühen zweiten Jahrhundert in Syrien entstandenen Didache wird deutlich, dass es in der Frühzeit noch eine hohe Variabilität im Ablauf der Feier gab.
Die terminliche Nähe zum jüdischen Passamahl wie auch die biblische Bezeichnung Jesu als Passalamm (1Kor 5,7Darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch unser Passalamm ist geopfert, das ist Christus.Zur Bibelstelle) legen es nahe, dass der Abendmahlsritus eine frühchristliche Überformung der jüdischen Passafeier darstellte. Die sich innerhalb des Judentums konstituierende Gemeinde, die kenntlich an dem Ruf „Maranatha“ (Didache 10,14) den Abendmahlsritus noch im aramäischsprachigen Kontext Palästinas formalisierte, würde dann mit dem Abendmahl eine Umsemantisierung eines zentralen jüdischen Ritus vornehmen und damit zu der Vorstellung der Substitution des Judentums durch das Christentum beitragen. Dies galt in den Anfängen in der Erwartung einer relativ begrenzten eschatologischen Zeit. Insofern lassen die frühen Berichte sich als eine Form erinnernder Vergegenwärtigung und zugleich Prolepse des Künftigen verstehen. Die Dynamik des Geschehens geht dabei überwiegend von der Gemeinde aus, die erinnert und vorausschaut.
Weiterführende Infos
Für eine umfassendere biblische Grundlegung, die das Abendmahl auch in die Praxis der antiken Mahlgemeinschaften einbettet und in verschiedene theologischen Deutungshorizonte des neutestamentlichen Befunds einführt sei auf den WiBiLex-Artikel von Karin Lehmeier verwiesen:
Lehmeier, Karin, Art. Abendmahl, in: WiBiLex (https://bibelwissenschaft.de/stichwort/48941/), abgerufen am 08.03.2025.
Vom Sinn des Abendmahls (Markus 14,17–19.22–26) Ein Vortrag von Prof. em. Siegfried Zimmer (Worthaus Podcast), 17.04.2014.
3. Historische Verzweigungen
Zu den Deutungen, die früh zu den biblischen Berichten hinzuwuchsen, gehört, wohl schon bei Ignatius von Antiochien ![]()
 (2. Jh.), ein die vorherigen Aspekte zuspitzendes Verständnis des Geschehens als Opfer, das bei dem syrischen Bischof auch mit einer starken soteriologischen Note verbunden ist. Schon Paulus
(2. Jh.), ein die vorherigen Aspekte zuspitzendes Verständnis des Geschehens als Opfer, das bei dem syrischen Bischof auch mit einer starken soteriologischen Note verbunden ist. Schon Paulus ![]()
 deutet in der Rede von einer „geistlichen Speise“ (1Kor 10,3f.[3] und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen [4] und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken; denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte; der Fels aber war Christus.Zur Bibelstelle) eine mögliche Heilswirkung des Essens an, die über einen reinen Gedächtnis- und Vergegenwärtigungsvorgang hinausgeht. Das wird bei Ignatius noch deutlicher: Das Abendmahl sei „Unsterblichkeitsmedizin”, „ein Gegengift gegen den Tod” (φάρμακον ἀθανασίας / pharmakon athanasias; IgnEph 20,2).1Die Apostolischen Väter. Griechisch-deutsche Parallelausgabe, neu übers. u. hg. v. Andreas Lindemann und Henning Paulsen, Tübingen 1992, 190f. Zu der von der Gemeinde ausgehenden Geschehensdynamik des Gedenkens – und Opferns – tritt damit eine Geschehensrichtung, in welcher Gott sich durch das Abendmahl der Gemeinde zuwendet. Damit wird auch die Frage nach der Weise, in welcher Gott mit dem Geschehen verbunden ist beziehungsweise sich darin präsent macht, unausweichlich. Im Zuge der Auseinanderentwicklung zwischen östlicher und westlicher Kirche betont die Liturgie und Theologie des Ostens sehr stark die pneumatologische Dimension des Geschehens: Der Geist bewirkt die tatsächliche Gegenwart Gottes und konzentriert diese auf die Gabe der Elemente. Debatten um den ontologischen Modus dieser Gegenwart spielten dabei nicht dieselbe Rolle wie in der westlichen lateinischen Theologie, die genau aufgrund dieser Frage zahlreiche Spaltungen erfahren hat.
deutet in der Rede von einer „geistlichen Speise“ (1Kor 10,3f.[3] und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen [4] und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken; denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte; der Fels aber war Christus.Zur Bibelstelle) eine mögliche Heilswirkung des Essens an, die über einen reinen Gedächtnis- und Vergegenwärtigungsvorgang hinausgeht. Das wird bei Ignatius noch deutlicher: Das Abendmahl sei „Unsterblichkeitsmedizin”, „ein Gegengift gegen den Tod” (φάρμακον ἀθανασίας / pharmakon athanasias; IgnEph 20,2).1Die Apostolischen Väter. Griechisch-deutsche Parallelausgabe, neu übers. u. hg. v. Andreas Lindemann und Henning Paulsen, Tübingen 1992, 190f. Zu der von der Gemeinde ausgehenden Geschehensdynamik des Gedenkens – und Opferns – tritt damit eine Geschehensrichtung, in welcher Gott sich durch das Abendmahl der Gemeinde zuwendet. Damit wird auch die Frage nach der Weise, in welcher Gott mit dem Geschehen verbunden ist beziehungsweise sich darin präsent macht, unausweichlich. Im Zuge der Auseinanderentwicklung zwischen östlicher und westlicher Kirche betont die Liturgie und Theologie des Ostens sehr stark die pneumatologische Dimension des Geschehens: Der Geist bewirkt die tatsächliche Gegenwart Gottes und konzentriert diese auf die Gabe der Elemente. Debatten um den ontologischen Modus dieser Gegenwart spielten dabei nicht dieselbe Rolle wie in der westlichen lateinischen Theologie, die genau aufgrund dieser Frage zahlreiche Spaltungen erfahren hat.
Die westliche Theologie lebte mit einem doppelten Erbe. Einerseits betonte sie im Abendmahl wie in allen Sakramenten die Zeichenhaftigkeit des Geschehens auf den Bahnen von Augustins ![]()
 Unterscheidung von signum (Zeichen) und res (Gehalt), die es erlaubte, beide Aspekte weit auseinanderzunehmen oder ineinander zu verschlingen. Andererseits überlieferte vor allem Gregor der Große
Unterscheidung von signum (Zeichen) und res (Gehalt), die es erlaubte, beide Aspekte weit auseinanderzunehmen oder ineinander zu verschlingen. Andererseits überlieferte vor allem Gregor der Große ![]()
 dem Mittelalter eine massive Betonung der materiellen Vergegenwärtigung Gottes in den Elementen, besonders dem Brot. Diese Differenz wurde erstmals im 9. Jahrhundert im Ersten Abendmahlsstreit zwischen Ratramnus
dem Mittelalter eine massive Betonung der materiellen Vergegenwärtigung Gottes in den Elementen, besonders dem Brot. Diese Differenz wurde erstmals im 9. Jahrhundert im Ersten Abendmahlsstreit zwischen Ratramnus ![]()
 und Paschasius Radbertus
und Paschasius Radbertus ![]()
 ausgetragen, ohne zu einer Klärung zu kommen. Mit dem zweiten Abendmahlsstreit aber wurde im 11. Jahrhundert die Vorstellung einer an die Elemente gebundenen, ontologisch definierbaren Gegenwart Christi für den lateinischen Westen bestimmend. Der Mönch Berengar
ausgetragen, ohne zu einer Klärung zu kommen. Mit dem zweiten Abendmahlsstreit aber wurde im 11. Jahrhundert die Vorstellung einer an die Elemente gebundenen, ontologisch definierbaren Gegenwart Christi für den lateinischen Westen bestimmend. Der Mönch Berengar ![]()
 hatte das Geschehen mit den Mitteln der aristotelischen Ontologie analysiert und festgestellt, es sei philosophisch nicht denkbar, dass die Akzidentien – die äußerlich wahrnehmbaren Eigenschaften von Brot und Wein – gleich blieben, darunter aber ihre Substanz sich in den Leib Christi verwandelte. In einem römischen Verfahren wurde er aber gezwungen, genau diese Gegenwart bis dahin zu bekennen, dass der Leib Christi mit den Zähnen zerrieben werde.2Vgl. Ego Berengarius (DH 690) [Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen (= Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum), verbessert, erweitert, ins Deutsche übertragen und unter Mitarbeit von Helmut Hoping hrsg. von Peter Hünermann, Freiburg i. Br. 452017]. Der Streit, den das Reformpapsttum gleichzeitig mit der griechischen Orthodoxie über das Abendmahl austrug, lag auf einer anderen Ebene: Der Westen blieb dabei, als Hostie für das Brot ungesäuertes Brot zu verwenden – und so den Anschluss an das Passaritual spürbar bleiben zu lassen –, während im Osten normales Brot verwendet wurde. Dies war einer der Streitpunkte, aus denen 1054 das Schisma zwischen Ost und West resultierte.
hatte das Geschehen mit den Mitteln der aristotelischen Ontologie analysiert und festgestellt, es sei philosophisch nicht denkbar, dass die Akzidentien – die äußerlich wahrnehmbaren Eigenschaften von Brot und Wein – gleich blieben, darunter aber ihre Substanz sich in den Leib Christi verwandelte. In einem römischen Verfahren wurde er aber gezwungen, genau diese Gegenwart bis dahin zu bekennen, dass der Leib Christi mit den Zähnen zerrieben werde.2Vgl. Ego Berengarius (DH 690) [Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen (= Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum), verbessert, erweitert, ins Deutsche übertragen und unter Mitarbeit von Helmut Hoping hrsg. von Peter Hünermann, Freiburg i. Br. 452017]. Der Streit, den das Reformpapsttum gleichzeitig mit der griechischen Orthodoxie über das Abendmahl austrug, lag auf einer anderen Ebene: Der Westen blieb dabei, als Hostie für das Brot ungesäuertes Brot zu verwenden – und so den Anschluss an das Passaritual spürbar bleiben zu lassen –, während im Osten normales Brot verwendet wurde. Dies war einer der Streitpunkte, aus denen 1054 das Schisma zwischen Ost und West resultierte.
Danach spitzten sich die Debatten der westlichen Theologie immer mehr auf die Frage zu, wie die Gegenwart Christi im Abendmahl denkbar sein sollte. Indirekt hatte Berengar bewirkt, dass eine aristotelische Begrifflichkeit für die dogmatische Bestimmung des Abendmahls verwendet wurde, gipfelnd in der Lehre des Vierten Laterankonzils von 1215, dass „unter den gewandelten (transsubstantiatis) Gestalten von Brot und Wein“3DH 802. Leib und Blut Christi gegenwärtig seien. Die Lehre von der Wandlung der Substanzen von Brot und Wein in Leib und Blut Christi hat dann Thomas von Aquin ![]()
 ausgearbeitet.
ausgearbeitet.
Als offizielle römisch-katholische Lehre bildete dies die Folie, auf die die Reformatoren reagierten. Martin Luther ![]()
 hielt es für unangemessen, Philosophie zum Teil eines christlichen Dogmas zu machen, insistierte aber auf der damit ursprünglich verbundenen Aussageabsicht, dass die Gegenwart Christi an die Elemente gebunden ist – „in, mit und unter“ den Elementen, wie die spätere lutherische Lehre sagte.4Vgl. FC.SD VII: „‚unter dem Brot‘, ‚mit dem Brot‘, ‚im Brot‘“ (BSELK 1,1468,22). Er erklärte dies nicht unter Verwendung des Substanz-Akzidens-Schemas aristotelisch, sondern mit der christologischen Lehre, dass sich die göttliche Eigenschaft der Allgegenwart auch auf die menschliche Natur Christi (vgl. Art. Zwei-Naturen-Lehre) übertragen habe und so der Leib Christi überall sein könne, wo dieser dies wolle (Ubiquitätslehre). Dem widersprach der Zürcher Reformator Ulrich Zwingli
hielt es für unangemessen, Philosophie zum Teil eines christlichen Dogmas zu machen, insistierte aber auf der damit ursprünglich verbundenen Aussageabsicht, dass die Gegenwart Christi an die Elemente gebunden ist – „in, mit und unter“ den Elementen, wie die spätere lutherische Lehre sagte.4Vgl. FC.SD VII: „‚unter dem Brot‘, ‚mit dem Brot‘, ‚im Brot‘“ (BSELK 1,1468,22). Er erklärte dies nicht unter Verwendung des Substanz-Akzidens-Schemas aristotelisch, sondern mit der christologischen Lehre, dass sich die göttliche Eigenschaft der Allgegenwart auch auf die menschliche Natur Christi (vgl. Art. Zwei-Naturen-Lehre) übertragen habe und so der Leib Christi überall sein könne, wo dieser dies wolle (Ubiquitätslehre). Dem widersprach der Zürcher Reformator Ulrich Zwingli ![]()
 , der das Abendmahl ausschließlich als ein zeichenhaftes Gedächtnismahl deutete, also die Gemeinde, nicht aber Gott als Akteur des Geschehens verstand. Seine Theologie wurde durch die Johannes Calvins
, der das Abendmahl ausschließlich als ein zeichenhaftes Gedächtnismahl deutete, also die Gemeinde, nicht aber Gott als Akteur des Geschehens verstand. Seine Theologie wurde durch die Johannes Calvins ![]()
 überlagert, der das Gesamtgeschehen als ein geistliches deutete, in welchem die Gegenwart Christi im Zusammenhang der Feier dadurch entsteht, dass einerseits die Gemeinde sich durch den Heiligen Geist zu Gott erhebt, andererseits dieser sich zu ihr herniederlässt. Er begründete damit das Abendmahlsverständnis der reformierten Kirchen, das neben Orthodoxie, Katholizismus und Luthertum einen vierten Typus repräsentiert und viele Freikirchen in ihrem Verständnis geprägt hat. Insbesondere reformierte und lutherische Abendmahlslehre sind mittlerweile, vor allem durch die Leuenberger Konkordie von 1973, in ihrem Verständnis zu weitgehenden Konvergenzen gelangt (s. u.).
überlagert, der das Gesamtgeschehen als ein geistliches deutete, in welchem die Gegenwart Christi im Zusammenhang der Feier dadurch entsteht, dass einerseits die Gemeinde sich durch den Heiligen Geist zu Gott erhebt, andererseits dieser sich zu ihr herniederlässt. Er begründete damit das Abendmahlsverständnis der reformierten Kirchen, das neben Orthodoxie, Katholizismus und Luthertum einen vierten Typus repräsentiert und viele Freikirchen in ihrem Verständnis geprägt hat. Insbesondere reformierte und lutherische Abendmahlslehre sind mittlerweile, vor allem durch die Leuenberger Konkordie von 1973, in ihrem Verständnis zu weitgehenden Konvergenzen gelangt (s. u.).
Weiterführende Infos
Vertreter der lutherischen, reformierten und unierten Kirchen verabschiedeten am 16.03.1973 im schweizerischen Leuenberg ein gemeinsames Dokument zur Überwindung ihrer konfessionellen Spaltung. Auf der Seite der EKD sind sowohl weiterführende Überblicksinformationen als auch ein Link auf den Text der Leuenberger Konkordie zu finden:
https://www.ekd.de/Leuenberger-Konkordie-11302.htm, abgerufen am 08.03.2025.
4. Theologische Probleme und Aufgaben
Aufgrund der vielfältigen historischen Entwicklung hat das Abendmahl sich zu einem Distinktionsmerkmal zwischen den Konfessionen entwickelt, dessen Gewicht durch den sakramentalen Charakter sehr hoch ist. Diese konfessionelle Bestimmtheit begrenzt den Spielraum individueller Theologien. Systematische Theologie ist an dieser Stelle in besonderem Maße konfessionelle Theologie und weniger konstruktive individuelle Leistung. Auch ein Versuch wie der Friedrich Daniel Ernst Schleiermachers ![]()
 , eine Abendmahlslehre zu formulieren, die jenseits der konfessionellen Lager in der evangelischen Kirche steht, bleibt auf eben diese konfessionellen Bestimmungen bezogen. Daher sind auch die folgenden Probleme vor allem anhand der konfessionellen Differenzen und der historisch gewachsenen Prägungen, aus denen sie hervorgegangen sind, zu verstehen.
, eine Abendmahlslehre zu formulieren, die jenseits der konfessionellen Lager in der evangelischen Kirche steht, bleibt auf eben diese konfessionellen Bestimmungen bezogen. Daher sind auch die folgenden Probleme vor allem anhand der konfessionellen Differenzen und der historisch gewachsenen Prägungen, aus denen sie hervorgegangen sind, zu verstehen.
4.1. Geschehensdynamiken
Die theologisch sehr komplexen Differenzen in der Deutung des Abendmahls lassen sich besser verstehen und sortieren, wenn man bedenkt, dass sich in ihnen unterschiedliche Vorstellungen von der Dynamik des Geschehens ausdrücken. Die Einsetzungsberichte der Evangelien legen zunächst eine Dynamik von den feiernden Akteuren aus nahe. Diese folgen einer Anweisung Christi, sein Gedächtnis mit Hilfe symbolisch belegter Gegenstände zu feiern, die ihn in zeichenhafter Weise vergegenwärtigen. In der Theologiegeschichte ist diese Dynamik von der Gemeinde aus besonders deutlich von Zwingli zum Ausdruck gebracht worden. Die radikale Gegenposition nimmt Martin Luther ![]()
 ein, nach dessen Deutung alle Dynamik des Geschehens von Gott bestimmt ist, der die Elemente so durchdringt, dass sie eine heilschaffende Wirkung haben. Die anderen drei Typen nehmen auf je unterschiedliche Weise eher Positionen ein, die die Geschehensdynamik zwischen Gott und Gemeinde als ein reziprokes Geschehen beschreiben. In der römisch-katholischen Lehre konzentriert sich dies auf die Person des Priesters, der in Stellvertretung der Gemeinde ebenso wie Christi das eucharistische Opfer vollzieht. Gott macht sich gegenwärtig – und eben diesen sich vergegenwärtigenden Gott kann die Gemeinde darbringen. Für den orthodoxen wie den reformierten Glauben konvergieren menschliche und göttliche Dynamik im Handeln des Geistes, der als göttliche Person in den Glaubenden gegenwärtig ist.
ein, nach dessen Deutung alle Dynamik des Geschehens von Gott bestimmt ist, der die Elemente so durchdringt, dass sie eine heilschaffende Wirkung haben. Die anderen drei Typen nehmen auf je unterschiedliche Weise eher Positionen ein, die die Geschehensdynamik zwischen Gott und Gemeinde als ein reziprokes Geschehen beschreiben. In der römisch-katholischen Lehre konzentriert sich dies auf die Person des Priesters, der in Stellvertretung der Gemeinde ebenso wie Christi das eucharistische Opfer vollzieht. Gott macht sich gegenwärtig – und eben diesen sich vergegenwärtigenden Gott kann die Gemeinde darbringen. Für den orthodoxen wie den reformierten Glauben konvergieren menschliche und göttliche Dynamik im Handeln des Geistes, der als göttliche Person in den Glaubenden gegenwärtig ist.
4.2. Soteriologie
Spätestens seit dem 2. Jahrhundert wurde die Vorstellung des Abendmahls mit dem Gedanken eines Opfers verbunden, das das Kreuzigungsgeschehen auf Golgotha neu in Kraft setzt. Dieses Konzept ist auf unterschiedliche Weise hinterfragt worden. Es setzt voraus, dass auch der Tod Jesu als Opfer verstanden wird, wofür es reichlich biblische Belege gibt.
Weiterführende Infos
„Im Gegensatz zu der vielfachen Rede vom ‚Opfer‘ Jesu in der modernen christlichen Theologie und Kirche mag es erstaunen, dass diese konkrete Ausdrucksweise im Neuen Testament auf den Epheser- und Hebräerbrief beschränkt ist. Die Bezeichnung Jesu als ‚Gabe und Opfer für Gott zum lieblichen Wohlgeruch‘ (προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, Eph 5,2) rezipiert Terminologie und Interpretamente des alttestamentlichen Opferkults, wobei letztere die kultische Verbrennung auf dem Brandopferaltar evozieren.“ Eberhart, Christian, Art. Opfer (NT). 4.2. Jesus als „Opfer“, in: WiBiLex (https://www.die-bibel.de/ressourcen/wibilex/neues-testament/opfer-nt), abgerufen am 08.03.2025.
Seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert ist dennoch verstärkt der mit dem biblischen Gottesbild schwer zu verbindende Aspekt der Grausamkeit eines Gottes, der seinen eigenen Sohn opfert, hinterfragt und in ein kritisches Verhältnis zur Betonung der Liebe Gottes gesetzt worden.5Vgl. hierzu insbesondere Grümbel, Ute, Abendmahl. „Für Euch gegeben“? Erfahrungen und Ansichten von Frauen und Männern. Anfragen an Theologie und Kirche, Stuttgart 1997.
Aber selbst wenn man das Kreuzesgeschehen als Opfer versteht, kann die Deutung auch des Abendmahls als Opfer in mehrfacher Hinsicht problematisch sein. Diese Vorstellung fand durch die Reformatoren Kritik, weil sie ein Tun von Seiten des Menschen voraussetze, welches der Lehre von einer Rechtfertigung allein aus Gnade und allein durch den Glauben widerspricht. Diese Kritik träfe allerdings nur ein Modell, in welchem das Abendmahl als eigenes Opfer neben oder auch nach dem Opfer auf Golgotha verstanden wird. Schon bei Thomas von Aquin ![]()
 ist erkennbar, dass es sich bei der Eucharistie nicht um eine eigene, neue Opferung handelt, die, wie die Reformatoren festhielten, dem ἐφάπαξ / ephhapax (Hebr 9,12Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt.Zur Bibelstelle), der einmaligen Opferung Jesus Christi widerspräche. Vielmehr handelt es sich ihm zufolge um eine Repräsentation des einmaligen Opfers Jesu selbst, ein Neupräsentwerden, das die Wirksamkeit des Kreuzesgeschehen für die gegenwärtig feiernde Gemeinde fruchtbar macht. Die Rede von einem Opfer wäre dann nur eine Variante der von jenen Konfessionen, die im Abendmahlsgeschehen zumindest eine Wirkungsdynamik von Seiten Gottes sehen, geteilten Auffassung, dass das sakramentale Geschehen des Abendmahls das am Kreuz begründete Heil denen neu zueignet, die in der nachfolgenden Kirche räumlich und zeitlich von diesem Ursprungsgeschehen getrennt sind. Das Abendmahl ist in diesem Sinne Teil des Vorgangs, durch den Gott die Glaubenden rechtfertigt und auch heiligt. Dies schließt andere, auch gänzlich freie Formen der Zueignung der Gnade nicht aus, bedeutet aber, dass Gott sein Heil in der Form des Abendmahls verbindlich zusagt und damit Glaubende sich darauf verlassen können, hier Heil und Rechtfertigung zu finden. Das ist der Grund für die strenge rituelle Regulierung des Abendmahls, etwa im Unterschied zu der sehr viel freieren Form der Agape: Die Gültigkeit dieser Zueignung des Heils hängt daran, dass der Vollzug der Einrichtung durch Gott entspricht. Besondere Bedeutung gewinnen hier die sogenannten Einsetzungsworte über Brot und Wein, die in den allermeisten Abendmahlsriten wörtlich – beziehungsweise in einer Kombination aus wörtlichen Bibelzitaten – im Mittelpunkt stehen.
ist erkennbar, dass es sich bei der Eucharistie nicht um eine eigene, neue Opferung handelt, die, wie die Reformatoren festhielten, dem ἐφάπαξ / ephhapax (Hebr 9,12Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt.Zur Bibelstelle), der einmaligen Opferung Jesus Christi widerspräche. Vielmehr handelt es sich ihm zufolge um eine Repräsentation des einmaligen Opfers Jesu selbst, ein Neupräsentwerden, das die Wirksamkeit des Kreuzesgeschehen für die gegenwärtig feiernde Gemeinde fruchtbar macht. Die Rede von einem Opfer wäre dann nur eine Variante der von jenen Konfessionen, die im Abendmahlsgeschehen zumindest eine Wirkungsdynamik von Seiten Gottes sehen, geteilten Auffassung, dass das sakramentale Geschehen des Abendmahls das am Kreuz begründete Heil denen neu zueignet, die in der nachfolgenden Kirche räumlich und zeitlich von diesem Ursprungsgeschehen getrennt sind. Das Abendmahl ist in diesem Sinne Teil des Vorgangs, durch den Gott die Glaubenden rechtfertigt und auch heiligt. Dies schließt andere, auch gänzlich freie Formen der Zueignung der Gnade nicht aus, bedeutet aber, dass Gott sein Heil in der Form des Abendmahls verbindlich zusagt und damit Glaubende sich darauf verlassen können, hier Heil und Rechtfertigung zu finden. Das ist der Grund für die strenge rituelle Regulierung des Abendmahls, etwa im Unterschied zu der sehr viel freieren Form der Agape: Die Gültigkeit dieser Zueignung des Heils hängt daran, dass der Vollzug der Einrichtung durch Gott entspricht. Besondere Bedeutung gewinnen hier die sogenannten Einsetzungsworte über Brot und Wein, die in den allermeisten Abendmahlsriten wörtlich – beziehungsweise in einer Kombination aus wörtlichen Bibelzitaten – im Mittelpunkt stehen.
4.3. Weisen der personalen Präsenz Christi
Die allgemeine Frage der Repräsentation des Geschehens auf Golgotha spitzt sich noch einmal auf die Frage der personalen Präsenz Christi zu. Grundlegend kann man hier in der Geschichte des Christentums idealtypisch einen eher pneumatologischen Ansatz, der eine reale Gegenwart Christi im Heiligen Geist lehrt, und einen ontologischen, der die Realpräsenz Christi an die Elemente Brot und Wein bindet, in denen Leib und Blut Christi voll und ganz gegenwärtig sind, unterscheiden. Die biblischen Textpassagen, an welchen dies diskutiert wird, sind wiederum die Einsetzungsworte. In der christlichen Überlagerung des Passagedenkens, die für den ursprünglichen Zusammenhang anzunehmen ist, handelt es sich zunächst um eine symbolische Aktualisierung eines historischen Geschehens. Die ontologische Deutung setzte erst später ein, wurde aber für den Hauptstrom der lateinischen Theologie bestimmend. Die Lehre von der Transsubstantiation gab der Realpräsenz philosophischen Ausdruck: Während die Akzidentien von Brot und Wein als äußere Merkmale unverändert blieben, verwandelte sich darunter die Substanz des Brotes in die Substanz von Leib und Blut Christi. Das gilt im Grundsatz auch für die abgewiesenen Alternativen von Annihilation (Vernichtung der Substanzen der Elemente und Ersetzung durch die Substanz von Leib und Blut) und Konsubstantiation (Hinzufügung der Substanz von Leib und Blut Christi), ebenso wie für das Insistieren Martin Luthers ![]()
 auf der leiblichen Gegenwart Christi. Für römisch-katholische wie lutherische Lehre ist diese Vorstellung einer an die Elemente gebundenen leiblichen Präsenz Christi bei allen Unterschieden in der Deutung bestimmend geblieben. Das impliziert, dass diese Gegenwart auf Grundlage der rechten Einsetzung gegeben ist, unabhängig von der individuellen Glaubensdisposition der Spenderperson oder der Empfangenden. Nach römisch-katholischer Auffassung bleibt diese Gegenwart unter den Elementen, nachdem einmal die Wandlung vollzogen wurde, auch nach dem Vollzug der Kommunion erhalten, so dass die Elemente, insbesondere das an einem besonderen Ort (Tabernakel) aufbewahrte Brot, dauerhafte leibliche Präsenzformen Christi sind. Nach lutherischer Auffassung ist diese leibliche Präsenz an das Kommunionsgeschehen im Rahmen der Liturgie gebunden und bleibt nicht darüber hinaus erhalten. Das Brot wird dann, theologisch streng gesprochen, wieder einfaches Brot.
auf der leiblichen Gegenwart Christi. Für römisch-katholische wie lutherische Lehre ist diese Vorstellung einer an die Elemente gebundenen leiblichen Präsenz Christi bei allen Unterschieden in der Deutung bestimmend geblieben. Das impliziert, dass diese Gegenwart auf Grundlage der rechten Einsetzung gegeben ist, unabhängig von der individuellen Glaubensdisposition der Spenderperson oder der Empfangenden. Nach römisch-katholischer Auffassung bleibt diese Gegenwart unter den Elementen, nachdem einmal die Wandlung vollzogen wurde, auch nach dem Vollzug der Kommunion erhalten, so dass die Elemente, insbesondere das an einem besonderen Ort (Tabernakel) aufbewahrte Brot, dauerhafte leibliche Präsenzformen Christi sind. Nach lutherischer Auffassung ist diese leibliche Präsenz an das Kommunionsgeschehen im Rahmen der Liturgie gebunden und bleibt nicht darüber hinaus erhalten. Das Brot wird dann, theologisch streng gesprochen, wieder einfaches Brot.
Eine geistorientierte Deutung findet sich zunächst in der orthodoxen Eucharistielehre. Die gedankliche Voraussetzung der hier leitenden Realpräsenzvorstellung bildet dabei ein platonisches Urbild-Abbild-Modell, wie es auch für die orthodoxe Bildertheologie leitend ist. Hiernach ist das Abbild – die Eucharistie – auf sein Urbild – Leib und Blut Christi – nicht allein in einer Zeichenbeziehung verbunden, sondern in einem realen Teilhabevorgang. Das Bild ahmt das Abgebildete nicht nur nach, sondern ist es infolge einer tatsächlich sich im Zuge der Feier vollziehenden Wandlung (μεταβολή / metabole) auch.
Anders als die orthodoxe Lehre hat die geistorientierte Erklärung Johannes Calvins ![]()
 und der ihm folgenden reformierten Lehren eine ontologische Realgegenwart in den Elementen bestritten. Der geistgewirkte Glaube der Empfangenden ist für die Gegenwart Christi mitkonstitutiv– wo seine Gegenwart nicht im Glauben angenommen wird, wird er zwar angeboten, ist aber nicht gegenwärtig. Umgekehrt gilt, dass durch das Wirken des Geistes im Abendmahl eine geistliche Realpräsenz entsteht: „It seems fair to say that Calvin agreed in principle with Aquinas and Luther on the fact of real and objective presence, but disagreed with them about the modes of presence and reception.“6Hunsinger, George, The Eucharist and Ecumenism. Let Us Keep the Feast, Cambridge 2008, 38. In Anerkennung dessen wurde es möglich, die konfessionellen Differenzen zu überwinden, wie das Beispiel der Leuenberger Konkordie von 1973 zeigt, in welcher sich eine große Anzahl evangelischer Kirchen zusammengefunden und bekannt hat:
und der ihm folgenden reformierten Lehren eine ontologische Realgegenwart in den Elementen bestritten. Der geistgewirkte Glaube der Empfangenden ist für die Gegenwart Christi mitkonstitutiv– wo seine Gegenwart nicht im Glauben angenommen wird, wird er zwar angeboten, ist aber nicht gegenwärtig. Umgekehrt gilt, dass durch das Wirken des Geistes im Abendmahl eine geistliche Realpräsenz entsteht: „It seems fair to say that Calvin agreed in principle with Aquinas and Luther on the fact of real and objective presence, but disagreed with them about the modes of presence and reception.“6Hunsinger, George, The Eucharist and Ecumenism. Let Us Keep the Feast, Cambridge 2008, 38. In Anerkennung dessen wurde es möglich, die konfessionellen Differenzen zu überwinden, wie das Beispiel der Leuenberger Konkordie von 1973 zeigt, in welcher sich eine große Anzahl evangelischer Kirchen zusammengefunden und bekannt hat:
Im Abendmahl schenkt sich der auferstandene Jesus Christus in seinem für alle dahingegebenen Leib und Blut durch sein verheißendes Wort mit Brot und Wein. Er gewährt uns dadurch Vergebung der Sünden und befreit uns zu einem neuen Leben aus Glauben. Er läßt uns neu erfahren, daß wir Glieder an seinem Leibe sind. Er stärkt uns zum Dienst an den Menschen.7https://www.ekd.de/Leuenberger-Konkordie-II-Das-gemeinsame-Verstandnis-des-Evangeliums-11307.htm, abgerufen am 08.03.2025.
Mit dem Papier „Gemeinsam am Tisch des Herrn“ hat der Ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen solche Ansätze auch für den Dialog zwischen römisch-katholischer und lutherischer wie reformierter Kirche weitergedacht und dabei den Akzent besonders auf die Bedeutung der Einladung zum Abendmahl durch Jesus Christus selbst gelegt, die über allen menschlichen Beschränkungen steht.
Keine der Weisen, die Gegenwart Christi im Abendmahl zu bestimmen, enthebt der Notwendigkeit, die Beziehung zwischen Elementen und Abendmahlsgeschehen einerseits und Jesus Christus andererseits semiotisch präzise zu fassen. Auch wenn die Gegenwart Christi ontologisch an die Elemente gebunden ist, gibt es eine auf ihn bezogene Zeichenfunktion, in welcher im Sinne augustinischen Denkens die Elemente als signum auf die res der in Christus geschenkten Gnade bezogen sind. Der von den Einsetzungsworten her nächstliegende semiotische Bezug liegt angesichts der Aufforderung „Dies tut zu meinem Gedächtnis“ in der lukanisch-paulinischen Fassung im Gedenken. Nur Ulrich Zwingli ![]()
 hat dies als einen reinen Vorgang menschlichen Erinnerns gedeutet, während alle anderen Deutungen auf die eine oder andere Weise hier eine Korrelation zwischen menschlichem Erinnern und göttlichem Geistwirken annehmen. Im reformierten Denken ist diese für die Gegenwart Christi konstitutiv, im römisch-katholischen oder lutherischen Denken mit der ontologischen Gegenwart verbunden. Dabei können allerdings Zeichenfunktion und Gegenwartsfunktion auseinandertreten: Während offenkundig das Brot für den Leib Christi steht und der Wein für sein Blut (so die Einsetzungsworte), besagt die im 12. Jahrhundert aufgekommene Konkomitanzlehre, dass ontologisch in jedem der Elemente mit dem einen Bestandteil des Körpers Christi auch der andere mitgegeben ist. Faktisch ist dies vor allem für das Brot bedeutsam, welches Leib und Blut Christi enthält und daher auch dann ein volles Abendmahl konstituieren kann, wenn der Gemeinde nicht der Kelch mit dem Wein gespendet wird – so der übliche römisch-katholische Ritus.
hat dies als einen reinen Vorgang menschlichen Erinnerns gedeutet, während alle anderen Deutungen auf die eine oder andere Weise hier eine Korrelation zwischen menschlichem Erinnern und göttlichem Geistwirken annehmen. Im reformierten Denken ist diese für die Gegenwart Christi konstitutiv, im römisch-katholischen oder lutherischen Denken mit der ontologischen Gegenwart verbunden. Dabei können allerdings Zeichenfunktion und Gegenwartsfunktion auseinandertreten: Während offenkundig das Brot für den Leib Christi steht und der Wein für sein Blut (so die Einsetzungsworte), besagt die im 12. Jahrhundert aufgekommene Konkomitanzlehre, dass ontologisch in jedem der Elemente mit dem einen Bestandteil des Körpers Christi auch der andere mitgegeben ist. Faktisch ist dies vor allem für das Brot bedeutsam, welches Leib und Blut Christi enthält und daher auch dann ein volles Abendmahl konstituieren kann, wenn der Gemeinde nicht der Kelch mit dem Wein gespendet wird – so der übliche römisch-katholische Ritus.
4.4. Gemeinde und Amt
Obgleich die Verkündigung des Evangeliums mit der Taufe allen Christ:innen aufgetragen ist, ist die spezifische Vermittlung von Gottes Gnadengaben durch Wort und Sakrament nach der Auffassung der meisten traditionellen Konfessionen an spezifische Amtsvorgaben gebunden. Lutherisches Verständnis fasst dies in dem Sinne zusammen, dass zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentenspendung – die beide zugleich die grundlegenden Kennzeichen von Kirche sind – nur ordinierte Personen befugt sind. Die Begründung hierfür liegt zum einen darin, dass es sich um einen institutionsbezogenen (im frühneuzeitlichen Sinne: öffentlichen) Vorgang handelt, zum anderen darin, dass der Zuspruch der Gnade nur von außen erfolgen kann und es daher hierzu besonders beauftragte Personen braucht. Für die römisch-katholische Kirche sind die Bedingungen, die eine legitime Ordination / Weihe begründen, nicht allein in diesem Vorgang selbst und seiner biblischen Begründung verankert, sondern auch in der Traditionskette der kirchlichen Hierarchie, der sogenannten Amtssukzession, die auf die Anfänge der Berufung der Apostel zurückgeführt wird. Dies führt zu einer engen Beziehung von Eucharistie und Kirche im römisch-katholischen Denken.
Es dürfte kein Zufall sein, dass die Konfessionsgemeinschaften, die in besonderer Weise ontologische Präsenzformen vertreten, auch dem Amt eine besonders starke Bedeutung für die Konstitution des Abendmahls zumessen. Dabei schwingen auch seit der Alten Kirche Vorstellungen vom Umgang mit dem Heiligen / Göttlichen mit, der besonderer Rahmenbedingungen bedürfe. Diese Amtsbetonung steht nicht im Gegensatz zu einer starken Betonung auch des Gemeindeaspekts – im Gegenteil: Seit dem frühen Mittelalter wurde der Bezug zwischen dem realen Leib Christi (corpus Christi reale), der Eucharistie, und dem mystischen Leib Christi (corpus Christi mysticum), als der nach 1Kor 12[12] Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind: so auch Christus. [13] Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. [14] Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. [15] Wenn nun der Fuß spräche: Ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib!, gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? [16] Und wenn das Ohr spräche: Ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib!, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? [17] Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? [18] Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. [19] Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? [20] Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. [21] Das Auge kann nicht sagen zu der Hand: Ich brauche dich nicht; oder wiederum das Haupt zu den Füßen: Ich brauche euch nicht. [22] Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten; [23] und die uns weniger ehrbar erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre; und die wenig ansehnlich sind, haben bei uns besonderes Ansehen; [24] denn was an uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, [25] auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. [26] Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. [27] Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. [28] Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. [29] Sind sie denn alle Apostel? Sind sie alle Propheten? Sind sie alle Lehrer? Haben sie alle die Kraft, Wunder zu tun, [30] haben sie alle Gaben, gesund zu machen? Reden sie alle in Zungen? Können sie alle auslegen? [31] Strebt aber nach den größeren Gaben! Und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen.Zur Bibelstelle die Gemeinde verstanden wird, hervorgehoben. Die hierüber hinausgehende Begründung der Gegenwart Gottes im Abendmahl durch den Geist der Glaubenden kann allerdings das Abendmahlsgeschehen näher an andere, weniger rituell gebundene Formen der Vergegenwärtigung Gottes im Glauben rücken. Entsprechend ist die Bedeutung des ordinierten Amtes im Zusammenhang mit einer überwiegend geistorientierten Deutung des Abendmahls theologisch weniger zwingend als in anderen Deutungen. Um so mehr Aufmerksamkeit kann dann dem gemeinschaftsstiftenden Aspekt des Abendmahls, in welchem die Gemeinde der Glaubenden sich gemeinsam in einem geistlichen Geschehen findet, gelten.
5. Kulturwissenschaftliche Aspekte
Die beschriebenen theologischen Begründungen des Abendmahls sind im Horizont heutiger kulturwissenschaftlicher Zugänge neu zu reflektieren, was zum Teil zu Reformulierungen führen kann, zum Teil auch zur kritischen Hinterfragung klassischer Konzepte. Letzteres gilt gewiss für die das Abendmahlsverständnis begründende paulinisch-augustinische Anthropologie, die stark von der Vorstellung des Menschen als Sünder bestimmt ist. Ihr entspricht zwar bis zu einem gewissen Grad die Bestimmung des Menschen als Mängelwesen durch Arnold Gehlen ![]()
 .8Vgl. Gehlen, Arnold, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, hg. v. Karl-Siegbert Rehberg, Frankfurt a. M. 2016. Es ist aber zu fragen, inwieweit der Sündenbegriff Verständnis für diese Begrenzung des Menschen hervorruft oder nicht vielmehr ein Verständnis verstellt, weil er als erniedrigend empfunden wird.
.8Vgl. Gehlen, Arnold, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, hg. v. Karl-Siegbert Rehberg, Frankfurt a. M. 2016. Es ist aber zu fragen, inwieweit der Sündenbegriff Verständnis für diese Begrenzung des Menschen hervorruft oder nicht vielmehr ein Verständnis verstellt, weil er als erniedrigend empfunden wird.
Hingegen sind andere anthropologische Aspekte aus den Humanwissenschaften für eine Vertiefung des Abendmahlsverständnisses förderlich. Als Mahl rückt das Abendmahl in den Horizont elementarer Essensvorgänge ein, die eine doppelte Bedeutung für das Abendmahl haben. Der eine offenkundige Aspekt ist der der sozialen Funktion von Gemeinschaftsmählern. Der Einsetzungsbericht von Paulus ![]()
 in 1Kor 11[23] Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe: Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, [24] dankte und brach’s und sprach: Das ist mein Leib für euch; das tut zu meinem Gedächtnis. [25] Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. [26] Denn sooft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.Zur Bibelstelle lässt erahnen, dass das Abendmahl ursprünglich als besonderes Element mit Gemeinschaftsmählern verbunden war und es gleichzeitig deutlich von Mählern rund um das pagane Opfer, in welchen Opferfleisch gegessen wurde, unterschieden war. Dass der ritualisierte Teil des Abendmahls sich demgegenüber verselbständigte und zum Teil einer gottesdienstlichen Liturgie statt eines Gemeinschaftsmahles wurde, hat diesen Aspekt in den Hintergrund rücken lassen. Ihn wiederzugewinnen, kann eine der Aufgaben von Abendmahlstheologie (im Zusammenhang der erwähnten Verhältnisbestimmung zur Agape) sein. Essen als ein Akt der Einverleibung schafft eine Nähe von höchster leiblicher Intensität, vergleichbar allein dem Sexualakt – jedoch mit dem Unterschied, dass dieser eine direkte Begegnung zwischen zwei Personen bedeutet, während die Personhaftigkeit Christi im Abendmahl unter den zeichenhaften Elementen von Brot und Wein verborgen ist. Die Essensmetaphorik wirft damit aus anthropologischer Perspektive – will man nicht auf den inadäquaten Vergleich des Kannibalismus kommen – eben die oben diskutierte hochkomplexe theologische Frage nach dem Präsenzmodus Gottes hervor und macht zugleich deutlich, dass hier leibliches Geschehen – Essen – und geistliches Geschehen – Gottesbegegnung – unlösbar ineinander liegen.
in 1Kor 11[23] Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe: Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, [24] dankte und brach’s und sprach: Das ist mein Leib für euch; das tut zu meinem Gedächtnis. [25] Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. [26] Denn sooft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.Zur Bibelstelle lässt erahnen, dass das Abendmahl ursprünglich als besonderes Element mit Gemeinschaftsmählern verbunden war und es gleichzeitig deutlich von Mählern rund um das pagane Opfer, in welchen Opferfleisch gegessen wurde, unterschieden war. Dass der ritualisierte Teil des Abendmahls sich demgegenüber verselbständigte und zum Teil einer gottesdienstlichen Liturgie statt eines Gemeinschaftsmahles wurde, hat diesen Aspekt in den Hintergrund rücken lassen. Ihn wiederzugewinnen, kann eine der Aufgaben von Abendmahlstheologie (im Zusammenhang der erwähnten Verhältnisbestimmung zur Agape) sein. Essen als ein Akt der Einverleibung schafft eine Nähe von höchster leiblicher Intensität, vergleichbar allein dem Sexualakt – jedoch mit dem Unterschied, dass dieser eine direkte Begegnung zwischen zwei Personen bedeutet, während die Personhaftigkeit Christi im Abendmahl unter den zeichenhaften Elementen von Brot und Wein verborgen ist. Die Essensmetaphorik wirft damit aus anthropologischer Perspektive – will man nicht auf den inadäquaten Vergleich des Kannibalismus kommen – eben die oben diskutierte hochkomplexe theologische Frage nach dem Präsenzmodus Gottes hervor und macht zugleich deutlich, dass hier leibliches Geschehen – Essen – und geistliches Geschehen – Gottesbegegnung – unlösbar ineinander liegen.
Auch aus dem kulturwissenschaftlich-soziologischen Diskurs, der die anthropologische Bedeutung der Gabe und des ihr entsprechenden Empfangens herausgearbeitet hat, ergeben sich neue Plausibilisierungen der Betonung des Handelns Gottes.9Vgl. Mauss, Marcel, Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften, Frankfurt a. M. 1990. Sowohl die eher reziproken Modelle im Katholizismus und Reformiertentum als auch das strikt auf das Handeln Gottes bezogene lutherische Modell lassen sich hiermit als „Gabe“ verstehen, die eine eigene Wirklichkeit im Menschen schafft.10Exemplarisch in der jüngeren Diskussion vgl. Miesner, Anje Caroline, Sich geben lassen. Das Abendmahl als wirkmächtiges Ereignis, Tübingen 2020. Aus soziologischer Perspektive sind auch die Überlegungen zu Amt und Gemeinde neu zu reflektieren und gegebenenfalls zu formulieren. Mit der zunehmenden Auflösung der Sonntagsgemeinde wird das Abendmahl immer mehr zu einem Sonderritus einzelner Spezialist:innen, die den Ritus und sein Verständnis kennen. Dies wird verstärkt durch Rahmenbedingungen, die immer mehr als Exklusionsmechanismen wahrgenommen werden. Relativ leicht zu beheben ist dabei die Exklusion etwa alkoholkranker Menschen durch den Gebrauch von Wein, da generell Traubensaft als äquivalent angesehen werden kann. Gewichtiger ist die Frage, welchen Grad an kognitiv bewusstem Glauben die Teilnahme am Abendmahl voraussetzt, wie also die Teilnahme von kleinen Kindern, Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Menschen mit dementieller Erkrankung eröffnet werden kann. Grundlage für eine inklusive Antwort muss hier ein vorkognitiver Glaubensbegriff sein, wie er vergleichbar von Verteter:innen der Säuglingstaufe verwendet wird. Während hier in der Regel das Bemühen um Inklusion leitend ist, ist es strittig, ob man auch die Inklusion nichtgetaufter Menschen wollen soll. Unter dem Gesichtspunkt einer zunehmenden Verschränkung religiös unterschiedlicher Sozialmilieus drängt sich diese Frage auf, während aus dogmatischer Perspektive darauf insistiert wird, dass die Begegnung mit Jesus Christus im Abendmahl nur dann heilbringend sein kann, wenn sie im Glauben an ihn als den Erlöser und Sohn Gottes geschieht.
Der Blick auf den sozialen Ort führt auch zur Frage nach anderen Feierformen. Insbesondere die Coronakrise hat Modelle der Lösung vom Sonntagsgottesdienst als Möglichkeit erscheinen lassen. Das Hausabendmahl wurde in Aktualisierung des allgemeinen Priestertums der Glaubenden als Feierform in kleinem privatem Kreis und ohne Beteiligung von Amtsträger:innen neu aktiviert, das Konzept eines digitalen Abendmahls nimmt sogar einen Horizont der Teilnahme einer räumlich verteilten, aber durch den Geist verbundenen Gemeinde in den Blick. Die Debatten hierüber11Vgl. exemplarisch Reimann, Ralf Peter/Leppin, Volker, pro und contra: Ist digitales Abendmahl sinnvoll?, (https://zeitzeichen.net/node/8326), abgerufen am 08.03.2025. haben affirmativ wie bestreitend deutlich gemacht, dass sich hierin neben der akuten Krise eine soziologisch länger zu beobachtende Entwicklung zur Geltung gebracht hat: dass nämlich auch im Glaubensleben engagierter Christ:innen der Gemeinschaftsaspekt gegenüber dem Aspekt der Vergegenwärtigung Christi spirituell in den Vordergrund gerückt ist.12Vgl. Rambusch-Nowak, Martina, „Nehmet hin…“. Erinnerung an die Zukunft. Gemeindetheologische Erwägungen zum Abendmahl, in: Müller, Wolfgang Erich/Konukiewitz, Enno (Hrsg.), Abendmahl heute. Reflexionen zur theologischen Grundlegung und zeitgemäßen Gestaltung, Frankfurt a. M. 2002, 69–94, 80f; Grümbel, Abendmahl, 302–363. Das steht in deutlicher Spannung zur Vorstellung vom Abendmahl als Gabe Gottes. Will man dieses als besonderes Kennzeichen des Abendmahls wahren, so ist zu bedenken, ob verstärkt Agapefeiern als Ort der Feier und Begründung der Gemeinschaft angeboten werden. Sie würden auch das Element einer nicht zwingend auf das kirchliche Amt angewiesenen priesterlichen Gemeinde stärker zur Geltung bringen, als es die klassische Abendmahlsfeier kann. Auch in diesen Debatten zeigt sich noch einmal der oben benannte, grundlegend konfessionelle Charakter von Abendmahlstheologie. Es ist für systematisch-theologische Ansätze einerseits unbefriedigend, dass Versuche konstruktiver Beschreibungen des Abendmahlsgeschehens sich immer auch an normativen konfessionellen Vorgaben zu messen haben, die ihrerseits die angesprochene Exklusionsproblematik und unter Umständen veraltete ontologische Voraussetzungen mit sich bringen. Zugleich zeigt sich aber gerade darin, dass das Abendmahl ein Akt christlichen Glaubens ist, der dem individuellen Gestaltungsraum vorgegeben ist. Es ist die Gemeinschaft unter den Christ:innen und die Gemeinschaft mit Gott, die in diesem Geschehen Ausdruck gewinnt – und dies bedarf immer auch der definitorischen Bestimmung der Grundlagen, die diese Gemeinschaft konstituieren. Für künftige Abendmahlstheologie kann es ein befreiender Schritt sein, das dialektische Verhältnis zum Agapemahl weiter zu entwickeln, das wichtige Elemente des Abendmahls, insbesondere den Gemeinschaftsaspekt, teilt, aber theologisch, rituell und sozial einen weiteren Gestaltungsraum zulässt. Es kann damit dem Wunsch nach Gemeinschaft und sozialer Offenheit Ausdruck geben. Das Abendmahl hingegen hat seine besondere Stellung darin, dass es einen definierten Vorgang darstellt, mit dem die Verheißung der sakramentalen Gabe der Gnade verbunden ist.
